 Mein Auto springt trotz Minusgraden problemlos an, auch wenn das Schloss der Fahrertür zugefroren ist, ich daher durch die Beifahrertür einsteigen musste und es eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis die Frontscheibe enteist ist, ich etwas sehen und wirklich losfahren kann. Ich schaffe es gerade so, Punkt elf Uhr an der Gedenkstätte in der Genslerstraße in Hohenschönhausen zu sein. Die Führung, die zu jeder vollen Stunde angeboten wird, hat just in diesem Moment begonnen. Zunächst wird eine Filmdoku zur Einführung gezeigt, ich kann problemlos noch dazustoßen und suche mir einen Sitzplatz.
Mein Auto springt trotz Minusgraden problemlos an, auch wenn das Schloss der Fahrertür zugefroren ist, ich daher durch die Beifahrertür einsteigen musste und es eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis die Frontscheibe enteist ist, ich etwas sehen und wirklich losfahren kann. Ich schaffe es gerade so, Punkt elf Uhr an der Gedenkstätte in der Genslerstraße in Hohenschönhausen zu sein. Die Führung, die zu jeder vollen Stunde angeboten wird, hat just in diesem Moment begonnen. Zunächst wird eine Filmdoku zur Einführung gezeigt, ich kann problemlos noch dazustoßen und suche mir einen Sitzplatz.
Dies ist oder besser war einmal ein Gefängnis, vor allem aber jahrzehntelang ein Ort politischer Verfolgung. Ursprünglich war auf dem Gelände eine Großküche der Nationalsozialisten, die Sowjetunion richtete hier im Mai 1945 das „Speziallager Nr. 3“ für Spione und politisch „feindliche Elemente“ ein. Die Häftlinge wurden unter katastrophalen Bedingungen auf engstem Raum zusammengepfercht, einer der prominentesten Gefangenen war der Schauspieler Heinrich George, der 1946 nach Sachsenhausen verlegt wurde, wo er wenig später starb.
 Ab 1947 entstand hier das zentrale sowjetische Untersuchungsgefängnis für Deutschland: Häftlinge mussten im Keller fensterlose Zellen bauen – feuchtkalt, mit lediglich sieben Luftlöchern in der Tür, nur ausgestattet mit Holzpritsche und einem Kübel für die Notdurft. Zu den Inhaftierten zählten neben NS-Verdächtigen mutmaßliche politische Widersacher: Vertreter demokratischer Parteien, aber auch Kommunisten und sowjetische Offiziere, die als nicht „linientreu“ erachtet wurden. Die meisten wurden später von Militärtribunalen zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt, fast alle, die Jahrzehnte später einen Antrag auf Rehabilitierung stellten, wurden von russischen Behörden für unschuldig erklärt.
Ab 1947 entstand hier das zentrale sowjetische Untersuchungsgefängnis für Deutschland: Häftlinge mussten im Keller fensterlose Zellen bauen – feuchtkalt, mit lediglich sieben Luftlöchern in der Tür, nur ausgestattet mit Holzpritsche und einem Kübel für die Notdurft. Zu den Inhaftierten zählten neben NS-Verdächtigen mutmaßliche politische Widersacher: Vertreter demokratischer Parteien, aber auch Kommunisten und sowjetische Offiziere, die als nicht „linientreu“ erachtet wurden. Die meisten wurden später von Militärtribunalen zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt, fast alle, die Jahrzehnte später einen Antrag auf Rehabilitierung stellten, wurden von russischen Behörden für unschuldig erklärt.
Anfang 1951 übernahm das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Geheimpolizei der SED, das Gefängnis und nutzte es bis 1989 als zentrale Untersuchungshaftanstalt. Insgesamt gab es in der DDR 17 MfS-Untersuchungsgefängnisse, die Zentrale war hier in Berlin-Hohenschönhausen. In den 1950er Jahren wurde das Kellergefängnis (auch „U-Boot“ genannt) zunächst weitergenutzt. Inhaftiert wurden hier diejenigen, die sich dem System widersetzten: ob Streikführer des Aufstands vom 17. Juni 1953, Anhänger der Zeugen Jehoves, in Ungnade gefallene Funktionäre oder auch SED-Kritiker aus dem Westen.
 1960 wurde ein Neubau mit zusammen über 200 Zellen und Vernehmerzimmern in Benutzung genommen. Der gesamte Gebäudekomplex war geheimer Sperrbezirk. Diejenigen, die verhaftet und hierher gebracht wurden, unter anderem weil sie aus der DDR fliehen wollten oder Fluchthilfe geleistet hatten, sollten nicht wissen, wo sie sich befinden. Der fensterlose, von außen getarnte Gefangenentransportwagen, man sieht vor Ort ein Originalfahrzeug, drehte im Zweifel Runde um Runde durch die Stadt, brauchte immer Stunden, um jede Orientierung unmöglich zu machen. Mit der friedlichen Revolution 1989 fand der Staatssicherheitsdienst sein Ende. Am 3. Oktober 1990 wurde das Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen geschlossen. Seit 1992 steht die Haftanstalt unter Denkmalschutz. Es sind vor allem ehemalige Häftlinge, die sich dafür eingesetzt haben, den Ort als Gedenkstätte zu erhalten und die heute als Zeitzeugen durch die Anlage führen.
1960 wurde ein Neubau mit zusammen über 200 Zellen und Vernehmerzimmern in Benutzung genommen. Der gesamte Gebäudekomplex war geheimer Sperrbezirk. Diejenigen, die verhaftet und hierher gebracht wurden, unter anderem weil sie aus der DDR fliehen wollten oder Fluchthilfe geleistet hatten, sollten nicht wissen, wo sie sich befinden. Der fensterlose, von außen getarnte Gefangenentransportwagen, man sieht vor Ort ein Originalfahrzeug, drehte im Zweifel Runde um Runde durch die Stadt, brauchte immer Stunden, um jede Orientierung unmöglich zu machen. Mit der friedlichen Revolution 1989 fand der Staatssicherheitsdienst sein Ende. Am 3. Oktober 1990 wurde das Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen geschlossen. Seit 1992 steht die Haftanstalt unter Denkmalschutz. Es sind vor allem ehemalige Häftlinge, die sich dafür eingesetzt haben, den Ort als Gedenkstätte zu erhalten und die heute als Zeitzeugen durch die Anlage führen.
Wolfgang Warnke ist es, der uns durch sein ehemaliges Gefängnis führt. Er ist Westdeutscher, wurde 1975 wegen versuchter Fluchthilfe an der bulgarischen Grenze verhaftet. Wie er später aus seiner Stasi-Akte entnehmen konnte, stand er vorher schon lange unter Beobachtung. Für vier Wochen war er in Untersuchungshaft in Hohenschönhausen. Man warf ihm vor, in kommerzielle Fluchthilfe verwickelt und Teil einer „kriminellen Menschenhändlerbande“ zu sein. Verurteilt zu einem Jahr und sechs Monaten, verbüßte er seine Haftstrafe im Zentralgefängnis Sofia. Seit er in Rente ist, führt er Besuchergruppen durch die Gedenkstätte. Manchmal sind es bis zu vier Führungen am Tag, fünf- manchmal sechsmal die Woche. Im vergangenen Jahr besuchten über 455.000 Menschen die Gedenkstätte, bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher pro Tag. So viele, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner schon über die vielen Reisebusse, die mit laufendem Motor in den Seitenstraßen warten, beschwert haben.
Der Rundgang ist bewegend, vielfach beklemmend – zum Beispiel, wenn Herr Warnke uns, eine Gruppe von 18 Personen, bittet, in eine der fensterlosen, bunkerartigen Gruppenzellen im Keller zu treten, in denen früher zehn Personen zusammen eingesperrt waren, obwohl vielleicht maximal die Hälfte liegend auf der Holzpritsche nebeneinander Platz hatten. Er selbst bleibt in der offenen Tür mit dem Rücken zum Gang stehen, wie einst die Wärter ihm gegenüber standen, nur so kann er an dieser Stelle über seine Erfahrungen berichten. Unmittelbar nach seiner Verhaftung in Bulgarien war er in einer vergleichbaren, kleineren Einzelzelle untergebracht. Es gab ein trockenes Brot pro Woche, ab und zu wässrige Suppe, die nicht satt machte, einen kurzen Freigang pro Tag, den er für die Hygiene nutzen konnte – Katzenwäsche mit kaltem Wasser. In Gedanken sagte er sich in der Zeit Gedichte auf, die er aus seiner Schulzeit erinnerte, formulierte in Gedanken Briefe an seine Familie und malte sich deren Antworten aus.
 Dann führt uns Herr Warnke durch den Zellentrakt im Neubau. Die Einzelzellen verfügen nun über Waschbecken und Toilette, eine Holzpritsche und einen Tisch mit Hocker. Es ist nicht erlaubt, tagsüber auf dem Bett zu sitzen und wer sich auf den Hocker setzt, darf dies nur aufrecht mit Blick zur Zellentür und muss die Hände stets auf dem Tisch halten. Alle drei Minuten wird durch den Spion an der Tür kontrolliert. In der Nacht erfolgt die Kontrolle alle 15 Minuten: Man darf nur auf dem Rücken liegen, die Hände müssen oberhalb der Bettdecke sein. An Schlaf ist kaum zu denken. Richtige Fenster gibt es auch hier nicht. Nur undurchsichtige Glasbausteine, die zwar Licht in die Zelle lassen, aber keinen freien Blick nach draußen erlauben. Auch der tägliche „Freigang“ findet nicht im Hof, sondern auf dem ummauerten Dach des Gebäudes statt – immerhin ein Blick zum Himmel ist hier möglich.
Dann führt uns Herr Warnke durch den Zellentrakt im Neubau. Die Einzelzellen verfügen nun über Waschbecken und Toilette, eine Holzpritsche und einen Tisch mit Hocker. Es ist nicht erlaubt, tagsüber auf dem Bett zu sitzen und wer sich auf den Hocker setzt, darf dies nur aufrecht mit Blick zur Zellentür und muss die Hände stets auf dem Tisch halten. Alle drei Minuten wird durch den Spion an der Tür kontrolliert. In der Nacht erfolgt die Kontrolle alle 15 Minuten: Man darf nur auf dem Rücken liegen, die Hände müssen oberhalb der Bettdecke sein. An Schlaf ist kaum zu denken. Richtige Fenster gibt es auch hier nicht. Nur undurchsichtige Glasbausteine, die zwar Licht in die Zelle lassen, aber keinen freien Blick nach draußen erlauben. Auch der tägliche „Freigang“ findet nicht im Hof, sondern auf dem ummauerten Dach des Gebäudes statt – immerhin ein Blick zum Himmel ist hier möglich.
 Die Häftlinge befinden sich in Isolation. Untereinander versucht man, sich von Zelle zu Zelle per simplem Klopfalphabet zu verständigen. Es gibt eine Bibliothek, aber nur wenigen Häftlingen wird es erlaubt, ein Buch zu lesen.
Die Häftlinge befinden sich in Isolation. Untereinander versucht man, sich von Zelle zu Zelle per simplem Klopfalphabet zu verständigen. Es gibt eine Bibliothek, aber nur wenigen Häftlingen wird es erlaubt, ein Buch zu lesen.
Auf den Gängen sorgt ein Lampen- und Ampelsystem dafür, dass kein Häftling auf dem Weg zur Vernehmung einem anderen über den Weg läuft. Eine Reißleine entlang aller Wände funktioniert als Notrufsystem für die Wächter bei „unvorhergesehenen Vorkommnissen“.

Wolfgang Warnke zeigt uns schließlich die Zelle Nr. 115. Das war die, in der er für vier Wochen eingesperrt war. Von dort aus wurde er Tag für Tag zur Vernehmung geführt. Auch eines der Vernehmerzimmer betreten wir gemeinsam. Herr Warnke setzt sich auf den Platz, wo einst sein Vernehmer saß. Die Gefangenen wurden manchmal monatelang und immer von ein und der selben Person verhört, um sie zu belastenden Aussagen zu bewegen. Kontakt zu Anwälten erhielt man in der Regel erst kurz vor der Verhandlung, aber die Verhörprotokolle dienten als Beweise im Prozess.
Warnke hat auch heute noch, wie andere ehemalige Häftlinge, mit den Folgen der Haft zu kämpfen. Aber er hat seinen Weg gefunden, wie er mit diesem Ort heute umgehen und eine Führung gestalten kann, die es ihm erlaubt über den Ort und das, was er hier erlebt hat, zu erzählen. Er will seinen Beitrag leisten zur Erinnerung. Es kommt vor, so erzählt er uns, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter in den Besuchergruppen sind, die ihn und die anderen Zeitzeugen als Lügner beschimpfen, bespucken. Ich frage ihn, ob er jemals wieder später Kontakt auch zu seinem damaligen Vernehmer hatte. Er sagt, nein, er habe auch nie versucht, Kontakt aufzunehmen. Er sagt, wenn dieser Mann einer derjenigen wäre, die kommen und sie alle als Lügner beschimpfen, dann müsste er ihn wohl hassen. Aber Wolfgang Warnke will niemanden hassen.
Als ich das Gelände verlasse, fängt es gerade wieder an zu schneien. Ein Moment der Dankbarkeit. Ich freue mich an meiner Freiheit. Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit. Der Freiheit, mir eine Zigarette anzuzünden. Nachdenklich fahre ich durch die Stadt zurück nach Hause.
Mehr Informationen:
Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen (Genslerstraße 66, 13055 Berlin) hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Dauerausstellung vor Ort ist frei. Eine Besichtigung des ehemaligen Gefängnisses ist nur im Rahmen einer Führung möglich (6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Schüler/innen 1 Euro). Führungen für Einzelbesucherinnen und -besucher finden am Wochenende stündlich zwischen 10 und 16 Uhr statt, in der Woche um 11, 13 und 15 Uhr.
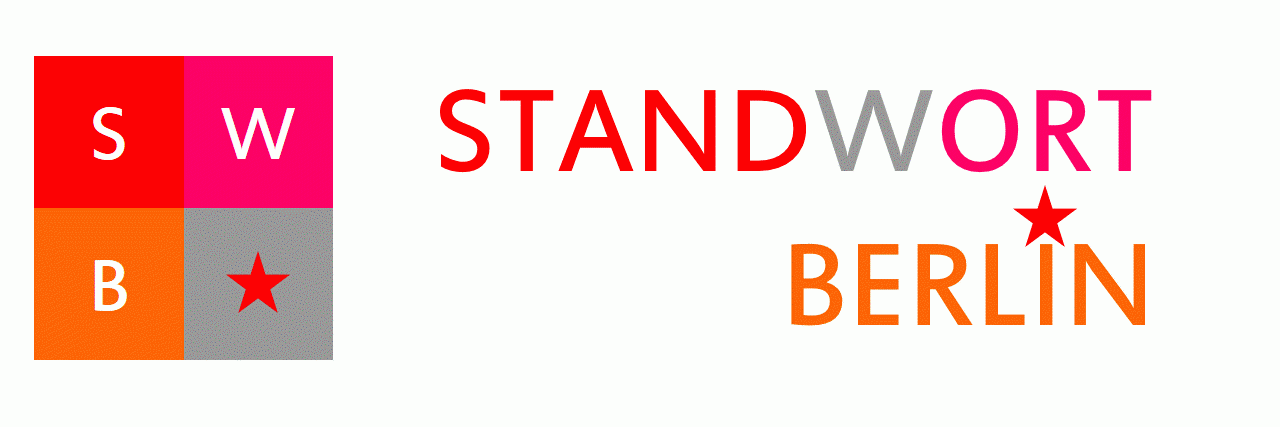
Liebe Gwendolyn,
grandios beschrieben, beklemmend, Du hast die Atmosphäre sehr gut getroffen. Lieben Dank! Ich freue mich auf all Deine nächsten Einträge.
Viele Grüße
Karin
Liebe Karin,
danke für Deine Rückmeldung! Das motiviert mich sehr. Freue mich schon drauf, wenn wir in den nächsten Wochen auch gemeinsam noch viele weitere, weniger beklemmende Orte entdecken und Worte dafür suchen und finden werden.
Viele Grüße,
Gwendolyn